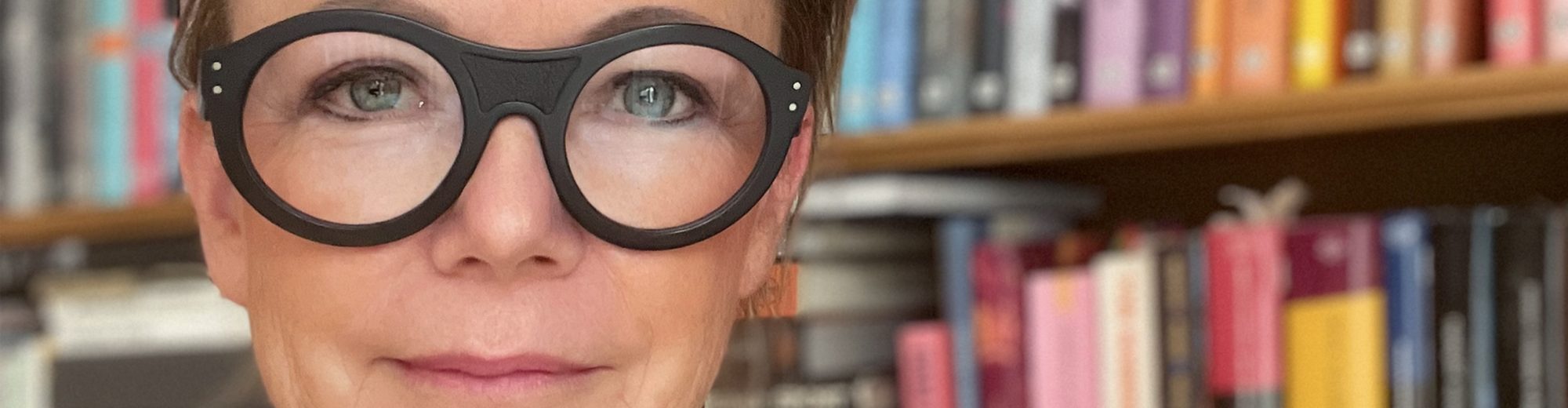Empfehlenswert in Corona-Zeiten: #hugatreenotme
René Estermann, 54, aufgewachsen in Olten und Wangen bei Olten, Agronom & Baumwärter und ab August 2020 Direktor des Umwelt-& Gesundheitsschutz der Stadt Zürich, verheiratet, 3 erwachsene Töchter, lebt seit 2001 am Waldhofweg.
Ein Mann soll in seinem Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und einen Sohn zeugen – diesem Luther zugeschriebenen Spruch wird René Estermann vollständig gerecht. Neben dem Hausbau hat er, dem 21. Jahrhundert und damit der Frauenemanzipation entsprechend, drei Töchter gezeugt. Und in Zeiten des Klimawandels und als früherer myclimate-CEO reicht es nicht mehr, einen Baum zu pflanzen, René hat Hunderte von Bäumen gepflanzt.
Seine besondere Beziehung zu Bäumen zeigt sich, wenn er seine Berufe als «Agronom und Baumwärter» angibt. Letzteres ist keine esoterische Bezeichnung, sondern ein handfester Titel der Obstbaufachstelle. René absolvierte die 30-tägige Ausbildung in seinem Maturajahr. Er erzählt, dass der Rektor in Olten damals keine Bedenken wegen der dafür nötigen Fehlzeiten hatte. Vielleicht auch, weil der Rektor dann zur ersten Kundschaft gehörte, der er die Bäume schnitt? Erfahrung mit Bäumen hatte René aber schon länger – sein Onkel Hans war Obstbauer in Rickenbach (Luzern). Ihm half er seit der Kindheit im Sommer bei den Erdbeeren, im Herbst bei den Äpfeln. Was ihn bei der Arbeit hielt, schmunzelt René, seien sicher auch die 7 (!) Cousinen gewesen. Bei ihnen war er der Hahn im Korb, für den Onkel Sohnersatz.
Die Leidenschaft
Im elterlichen Garten hatte René Erfolg mit allen Fruchtkernen, die er neugierig gepflanzt hatte. Dank dem Onkel hatte er gelernt, die Bäumchen zu veredeln. Aber bald einmal war der Garten voll. Mit ca. 17 Jahren suchte er also einen Bauern, der ihm Land für seine Bäume gab. Im Oltner Gheid fand sich eine Hofstatt, wo er 35 Are für 25 Jahre pachten konnte. Neben den uralten Bäumen, die bereits dort standen, pflanzte er ein halbes Dutzend Kirschbäume an, ein Dutzend Zwetschgen- und haufenweise Apfelbäume. Sein Vater half beim Heuen und bei der Verarbeitung u.a. zu Most, Dörrobst und Schnaps. René lebte seine Passion weiter aus, indem er Agronomie studierte. Und als er mit seiner Familie 2001 am Waldhofweg das Haus baute, lag dahinter wieder so ein alter Baumgarten. Er gehört zur Stiftung Galegge. Weil er den Humus vom Aushub für das Haus dort deponieren wollte, kam er mit ihr in Kontakt. Und natürlich – er bot an, den Baumgarten zu pflegen und zu verjüngen. Inzwischen hat er dort zwischen die 50 bis 80-jährigen alten Bäume 150 neue gepflanzt.

Ein Kirschbaum, 2001 gepflanzt
Der Baumgarten
In diesem bilderbuchartigen Frühling 2020 blühen die Bäume in besondere Pracht. «Dank» dem lock-down wegen der Corona-Pandemie hatte René viel Zeit, Coiffeur zu spielen: «Die alten Baum- Damen und Herren haben alle eine frische Frise bekommen!». Was von dieser Arbeit ausser den ausgelichteten Baumkronen sichtbar ist, sind die grossen «Astnester» zwischen den Bäumen. Ein junger Mann aus Eritrea hilft René und hat das Talent, aus den abgeschnittenen Ästen kunstvoll Objekte zu schichten. Sie sind nicht nur ästhetisch, sondern bieten allen möglichen tierischen Nützlingen Unterschlupf.
René erzählt, wie er jedes Jahr beim Baumschneiden den Ausblick auf den Jura geniesse, nun den Blütenduft und natürlich die Früchte. Neben den Äpfeln kann er Mirabellen, Kirschen, Birnen, Quitten, Walnüsse und Zwetschgen ernten. Das Obst erhält keinerlei Pflanzenschutz, daher ist die Ernte unregelmässig und nicht so gross. Aber immerhin 8’000 Liter Most gab es im 2018! Wer mit René zusammenarbeitet, kann sicher sein, mit Süssmost versorgt zu werden. Bei der Ernte (und dem anschliessenden Bräteln) helfen denn auch immer die Arbeitskollegen und ihre Familien. Die Herkunft seiner drei «Öpfuschampis» oder seiner neusten Kreation, dem Sweet-Cidre «Pommes d’Or», benennt René auf der Etikette mit «Aarau Süd». Aarau können die Zürcher KollegInnen eher orten als Suhr – ganz abgesehen von den Missverständnissen, die es bei «Suhrer Most» geben könnte…
Die Marroni Pflanzung
René erklärt, der «Süden von Aarau», also Suhr mit seinem Mikroklima, sei eine eigentliche Weinberglage. Das brachte ihn dazu, im letzten Jahr 74 Marronibäume zu pflanzen – eine lange Reihe oberhalb des Baumgartens, nahe dem Waldrand. Die insgesamt 15 Sorten stammen zum grossen Teil aus den Föhnregionen der Schweiz (Walen- und Vierwaldstättersee, Rheintal, Zug), den traditionellen Marroni-Anbaugebieten nördlich der Alpen, ergänzt mit französischen Edel-Sorten.
Den einjährigen Setzlingen (linkes Foto) muss die Spitze gekappt werden, damit sie schöne Äste machen (rechtes Foto, Setzling von letztem Jahr).
Der Rat an die GärtnerInnen
Die Sortenbezeichnungen der alten Apfelbäume klingen skurril bis poetisch: «Geheimrat von Breuhahn», «Portugiesische Leder-Reinette», «Zabergäu». Der «Stäfner Rosenapfel» ist ein wunderschöner Schneewittli-Apfel. Man muss ihn aber bis Februar aufbewahren, damit er sein volles Aroma erreicht. Das ist bei vielen alten Sorten so, die, auf den Hurden im Keller gelagert, bis ins Frühjahr Vitamine liefern mussten. «Bohnäpfel» wiederum sind gute Mostäpfel und es gibt Sorten, die sich speziell für Apfelmus eignen. «Aargauer Jubiläum» ist so einer – er ist gross, bleibt weiss beim Anschneiden und lässt sich maschinell gut verarbeiten. Das «Hero»-Apfelmus verdankte ihm seine Sämigkeit. Zu Ehren des 100-jährigen Jubiläums des Kantons Aargau wurde diese Sorte 1903 so benannt. René ehrte den Kanton durch einen neuen Baum neben dem alten.

Rechts der alte „Hero“-Apfelbaum, links der junge.
Er findet, dass in jeden Garten ein Baum passt, seit es Züchtungen mit kleinerem Wurzelwerk gibt – die Spindel- oder Säulenbäume. Sorten mit «Re-» am Anfang weisen auf die Resistenz gegen Pilz und Mehltau hin (z.B. «Rewena» oder «Reanda»). Der «Spartan», ein resistenterer Ersatz für die «Berner Rose», sei eine schöne, rote, immer tragende Sorte. Empfehlenswert sei auch der «Gewürzluiken», aromatisch, saftig, mit leichter Säure, der schon ab November fein schmecke. Für seinen Vater muss René den «Verenacher» pflegen. Er liefert die spezielle Süsse für die Solothurner Spezialität «Schnitz und Drunder».
Das Rezept
Vielleicht streiten nun die Solothurner und die Aargauer darum, für wen «Schnitz und Drunder» wirklich typisch sei. René beschreibt auf jeden Fall das solothurnische Familien-Rezept so:
– 3-4 EL Zucker mit 1 EL Wasser caramelisieren, mit wenig Wasser ablöschen.
– Insgesamt 250 g getrocknete Äpfel und Birnen dazu – die süssen Äpfel und
die weichen «Speckbirnen» wenn vorhanden.
– 500 g geräucherten Kochspeck in Scheiben dazu.
– Mit 3-4 dl Bouillon auffüllen – sie sollte 1-2 Finger breit über allem stehen.
– 30 Minuten dämpfen, hie und da umrühren.
– 750 g Kartoffeln in Schnitzen, ein wenig Salz und Pfeffer beigeben.
– In 20-25 Minuten fertigkochen.
Und jetzt könnte René noch von den Vögeln erzählen, die im Baumgarten leben oder dort Station machen, aber das ist ein anderes Thema…entlang dem Wäscheständer zwischen den Bäumen, «Pastorenbirnen», Sauerkirschen und «Chatzeseicherli»-Reben an der Hausmauer, geht die Dorfschreiberin erfüllt vom Apfelkosmos nach Hause.